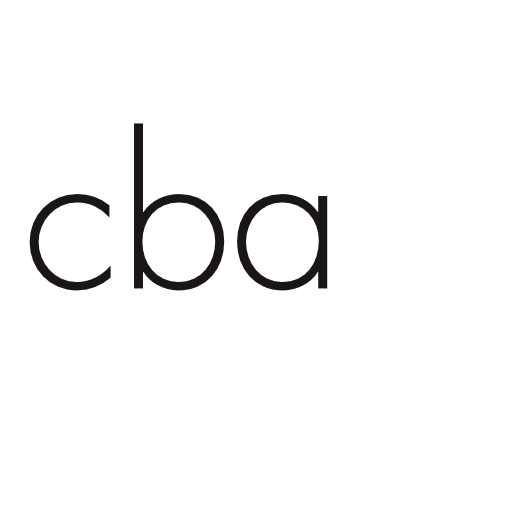Plädoyer für ein freies Spinnen in der Krise
in: Hotspot Berlin – Eine Momentaufnahme
Hrsg. Sebastian C. Strenger Berlin 2011
Auch in Krisenzeiten – Für ein freies Spinnen in der Kunst
Nachdem man sich der Kunstmarkt nach dem Crash im Herbst 2008 aus der ersten Schockstarre befreit hatte, war Gelegenheit für Neuorientierung, Analyse der Fehler, eingehende Reflexionen, neue Strategien, Konzentration auf das Wesentliche und damit Abwerfen von Ballast. Ob das im internationalen Finanz- und Wirtschaftssystem nach dem Crash im Herbst 2008 so gesehen wurde, bezweifle ich, vermag es jedoch nicht wirklich zu beurteilen.
Wie sieht es auf dem Kunstmarkt aus, der als Folgeerscheinung auch für mindestens eineinhalb Jahre wie paralysiert schien? Was waren hier die Fehler der Vergangenheit und welche Chancen hätten sie im Idealfall eröffnen können?
Ich erinnere mich an ein Erlebnis in der Galerie in der Woche des Lehman Brothers Zusammenbruchs, das mich innerlich triumphieren ließ und mich nicht in Lethargie und Pessimismus versinken ließ. Eine Sammlerin, die nur wenige Tage in Berlin war, kam genau in der Woche des Crashs in die Galerie, um sich umzuschauen und zu informieren. Ich zeigte ihr verschiedene Arbeiten, berichtete ihr über diverse Künstlerinnen und Künstler, die sie kannte, wir unterhielten uns über alles Mögliche aus der Kunstwelt, nur nicht über die aktuellen Ereignisse. Wir hatten offensichtlich beide nicht spekuliert. Sie begeisterte sich für eine großformatige Leinwand von Cornelia Schleime, ein einnehmendes, provokatives Frauenbildnis, das man in seiner Präsenz aushalten können musste. Die pastose, schrundige Malweise des verwendeten dunklen Asphaltlacks, der eine spröde und raue Oberfläche hinterlässt, der Schelllack, der glatte Flächen zersetzt, Makellosigkeit weg ätzt. Diese Malerei dokumentiert, dass hier jemand mit Farbe und Leinwand gekämpft und gerungen hat. Auch der Preis, knapp unter 40.000 € nicht unbedingt bequem für eine mittlere Käuferschicht. Es war keine leichte Entscheidung für sie, kein leichter Verkauf für mich, aber am Ende dieses Nachmittags entschied sie sich, das Wagnis einzugehen, mit diesem Bild leben zu wollen. Als sie die Galerie verließ, freute ich mich wahnsinnig über diesen Verkauf, es war anders als sonst. Wir hatten uns auf einer Gedankeninsel bewegt, uns mit einem Wert beschäftigt, der fern von Investment lag, und das in diesen legendären Tagen. Zwei Exotinnen, die so taten, als ginge sie der Lauf der Wirtschaftswelt nichts an ? Nein, keine Trotzreaktion, keine Ignoranz, sondern ich hatte ihr etwas in meinen Augen Wertvolles gezeigt und die Sammlerin hatte darin ebenfalls etwas entdeckt, das fern von Prestige oder Trend liegt. Wir hatten den Markt, der das wichtigste Messinstrument für Kunst geworden war, gar nicht mit berücksichtigt. Natürlich ist Cornelia Schleime keine unbekannte Künstlerin, sie hat ihren Platz auf eben diesem Markt, und doch war der Grund für diese Kaufentscheidung ein anderer. Es war das Wagnis, sich mit dem Geheimnis der Malerei zu beschäftigen, sich auf die Geschichten einzulassen, die das Gemalte andeuteten. Irgendwie standen wir wieder an der Wurzel des mächtigen Kunstmarktbaumes, der in den letzten Jahren mit funkelnden Diamanten lockte.
In den Boomzeiten bedeutete Wert gleich Preis, der Wortgehalt von wert schätzen, ehren, eine Bedeutung zumessen, kam kaum zum Tragen. So schreibt Peter Raue in einem ZEIT-Artikel „Sammeln wir die falsche Kunst?“ vom 14.1.2010: „ Längst hat der Kunstmarkt den Merkvers ‚ Was gut ist, ist auch teuer‘ pervertiert in die Erkenntnis ‚ Was teuer ist, ist gut‘ „ (1)
Man orientierte sich daran, bei welchem Galeristen der Künstler unter Vertrag war, welche Auktionsergebnisse erzielt wurden, wie der Platz auf Rankinglisten war, an der medialen Präsenz. Über Qualitätsmerkmale der Kunst wurde kaum gesprochen.
Wie ist es heute, nach halbwegs überwundener Krise? Kann man sich heute hinstellen und wieder nach Bedeutung fragen? Findet ein Künstler wie Hrdlicka, der in seiner Kunst vorstoßen wollte zu dem, was den Menschen ausmacht, ihn anrührt, ihn verzweifeln lässt, wieder ein offenes Ohr bei uns? Ist ein Titel des art-Magazins vom Februar diesen Jahres „Der neue Hang zum Heiligen“ ein Indiz für die Suche nach anderen Werten? Haben die Galeristen, die ihre Strategien überdenken mussten, ihre Messepräsenzen teilweise eingeschränkt hatten, ihre Räume verkleinert oder geschlossen haben, auch die Kunst, die sie vertreten, auf ihre Qualität hin überprüft ?
Fast alle Messekritiken der letzten beiden Jahre haben den Tenor, dass man eher auf Nummer sicher zu gehen scheint, Abgesegnetes statt Risiko. Die Rasanz des Toppens und Hypens lässt sich nicht ewig durchhalten. Vielleicht ist dies aber auch eine Art der Besinnung, des Durchatmens. Zeit hierfür sollte man sich immer nehmen, vor, nach und mitten in der Krise, das gilt für Hedgefonds Manager genauso wie für Künstler, Galeristen, Sammler. Die Frage nach der Qualität von Kunst muss zu allen Zeiten, in guten und in schlechten, vor der Frage nach dem Preis stehen. Natürlich braucht ein Künstler ein gesundes Marketing, aber selbiges schien die Beschäftigung mit der Kunst zu ersetzen.
Das 2007 erschienene Buch „Und das ist Kunst ?! Eine Qualitätsprüfung“ von Hanno Rauterberg leistet hier Pionierarbeit. Es geht kritisch mit der so genannten Hype-Kunst um, die ausschließlich vom Markt und seinen Multiplikatoren bestimmt wird. Hanno Rauterberg versucht, Kriterien für eine Qualitätsbestimmung zeitgenössischer Kunst aufzustellen, gibt Anregungen zum Bewerten von Kunst. Er wirbt um ein qualitätsvolles Sehen, um ein Schulen der eigenen Wahrnehmung, um Mut, sich auf das eigene Kunstgefühl zu verlassen. Mit Worten wie Erhabenheit, Wahrhaftigkeit, Glaubwürdigkeit widersetzt er sich schon im Sprachgebrauch den Schlagworten des Kunstmarktbooms. Man mag seine Thesen für rückwärtsgewandt halten, sie sind es wert, sich damit auseinander zu setzen.
Jetzt, wo es seit einiger Zeit wieder bergauf geht, aber noch genügend Bewusstsein für die Fragilität unseres Wirtschaftssystems vorhanden ist, und es auch immer wieder skeptische Stimmen gibt, ob es nicht doch nochmal zu einem Einbruch kommt, sollte man dran bleiben, Um- und Neuorientierung zu reflektieren.
Wir, die wir im Kunst-und Kulturgeschehen tätig sind, haben das Privileg, einen großen Freiraum dafür nutzen zu dürfen.
„Wer aber Kunst und ihren Betrachtern das freie Spinnen abgewöhnen will, nimmt ihnen zugleich das, was so oft vermisst und eingefordert wird: die Lust am utopischen Denken. Es braucht ja Einbildungskraft, um etwas auszubilden, um sich etwas vorzustellen, das nicht im heute liegt“ (2)
Ob Hausse oder Baisse an der Börse, ob gutes oder schlechtes Auktionsergebnis eines Künstlers, Kunst muss berühren, uns eine Geschichte enthüllen lassen, uns Horizonte eröffnen und uns im Idealfall sogar in die Knie gehen lassen.
Wann haben Sie das letzte Mal vor einem Kunstwerk gekniet, wann haben Sie das letzte Mal gesponnen, in der Krise, vor der Krise oder danach?
Christiane Bühling
1 – Artikel in: DIE ZEIT, Nr.3, 14.1.2010, Peter Raue „Sammeln wir die falsche Kunst ?“, S. 49/50
2 – Hanno Rauterberg, „Und das ist Kunst ?! „ Fischer Taschenbuch Verlag Frankfurt a.M., 2008, S. 184,