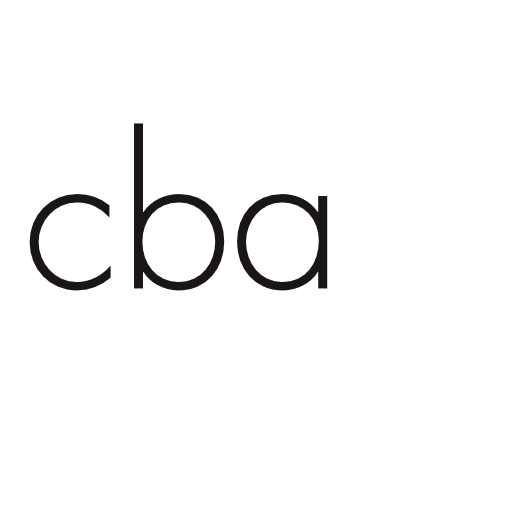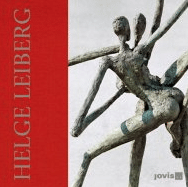Scharwenzeln tanzen
Schleichen tingeln
Schwadronieren tollen
Schlenkern toben
Schlüpfen trachten
Springen trampeln
Spreizen taumeln
Spazieren turteln
Strecken tätscheln
Stolzieren torpedieren
Staksen triumphieren
Stürmen taktieren
Stelzen treiben
Streiten tummeln
Stemmen torkeln
Eine Einstimmung in die Bildwelt von Helge Leiberg, in der der agierende Künstler und die von ihm geschaffenen energiegeladenen Figuren auf dem Papier, der Leinwand, in der Skulptur auch uns als Betrachter auf Trab halten. Innehalten kommt schon ab und an vor, aber niemals Stillstand.
Also, eine CD in den Rekorder werfen und abrocken oder ohne Anregung von außen, dem inneren Rhythmus leise lauschen. Die künstlerische Palette Helge Leibergs spannt so einen weiten Bogen von Extrovertiertheit und Introvertiertheit und bringt unzählige Nuancen in deren Zwischenbereich zur Darstellung.
Egal, ob sich seine Figuren ekstatisch verhalten und ihre Gliedmaßen schlenkender und sich biegender Weise durch die Luft werfen, oder ob sie selbstvergessen in geschlossener Körperhaltung durch die Welt schreiten, ihr Geist ist immer in Bewegung, denn ohne diese geht nichts beim Künstler. Entsprechend finden wir Titel seiner Ausstellungen in den letzten Jahrzehnten wie: „Heftige Begegnungen“, „Step by Step“, „Keep on Moving“, „Wild Jump“, „Dirty Dancing“, „Stürmische Ankunft“ aber auch „Stumme Diener“, „Läuterung“, „Berührungen“.
Diese Antriebsfeder gilt für alle Medien, in denen sich der Künstler tummelt und die sich alle untereinander inspirieren und beeinflussen. Helge Leiberg ist Zeichner, Maler, Grafiker, Bildhauer, Buchillustrator, Musiker, zu DDR-Zeiten auch Filmemacher. Voller Tatendrang trotzt er mit seinen Pinseln, Federn, Stiften, Wachsmassen, Lithosteinen und Radierplatten allem Statischen. Er malt, zeichnet, modelliert und ritzt die Menschliche Komödie in einem mitreißenden schnörkellosen und intuitiv elegantem Schwung.
Bekannt ist er auch für seine Performances mit Musikern, Tänzern und Schauspielern oder Autoren. Leiberg selbst, der das Noise Painting begründet hat, zeichnet dabei live auf der Folie eines Overheadprojektors. Vor dem an die Wand projizierten Bild, das sich ständig verändert, ergänzt, weggewischt wird, neu gezeichnet wird, bewegt sich eine Tänzerin, ein Schauspieler. Begleitet werden sie von Musikern, Gitarristen oder Saxophonspielern, manchmal von Sängerinnen, manchmal von Lesenden. Die Zusammensetzung der Performancegruppe wechselt, die kleinste Einheit bildet Leiberg und ein Musiker, die größte Einheit beinhaltet dann Musik, Tanz, Wort, Zeichnung. Entscheidend ist das gleichwertige Miteinander. Eine intellektuelle und künstlerische Partnerschaft ist die Basis, in der sich alle gegenseitig verstärken und anregen. Sie strecken und recken sich nacheinander, stoßen aufeinander zu, stoßen sich ab und finden wieder zusammen, eine spannungsvolle Mannschaft, die ein Welttheater mit Licht- und Schattenseiten orchestriert. Ein Ton inspiriert einen Strich, ein Pinselschwung setzt sich im sich biegenden Körper der Tänzerin fort, ein Wort verwandelt sich in eine Note, die Federführung entwächst einem Wort und wird zur Figur.
Das Bedürfnis nach Austausch unter den Künsten und deren wechselseitige Inspiration finden sich auch bei der Gestaltung seiner Künstlerbücher wieder, die bereits zu DDR-Zeiten ein wichtiges Glied seines Schaffens bildeten. Es geht um Kommunikation und eine Befruchtung auf Augenhöhe zwischen Wort und Bild, so wie z.B. bei seiner Zusammenarbeit mit Christa Wolf. Auch zu Shakespeare Sonetten, Arno Schmidt oder Friedrich Schillers Gesamtausgabe gibt es Leibergsche Illustrationen oder originalgrafische Künstlerbücher. Einer alten Tradition aus DDR-Zeiten treu bleibend, hält Leiberg alljährlich ein Treffen mit Künstlerkollegen von damals aufrecht. Sie versammeln sich am „Tag des freien Buches“ am 10.Mai, um gemeinsam ein Buch mit Originalen zu gestalten. So schufen sie sich damals Freiräume, um gegen Schablonendenken zu rebellieren, sie ermalten und erzeichneten sich eine Freiheit des Geistes. Diesen Impetus will man wach halten.
Die Erkenntnis und Beschäftigung mit dem eigenen Ich, die die Grundlage für eine innere Freiheit bilden, ziehen sich bis heute durch sein gesamtes Werk und nahmen hier vielleicht ihren Ursprung.
Die Idee, den Freiheitsgedanken, das Ausloten der eigenen Identität und das Zusammenspiel von Paaren mittels einer schwungvollen Figur auszudrücken, entspringt der Beschäftigung und der Zusammenarbeit mit Tänzerinnen und Musikern. Insbesondere der Ausdruckstanz scheint es dem Künstler angetan zu haben. Die klassischen zartgliedrigen Ballerinen interessieren ihn dabei weniger. Auch Ernst Ludwig Kirchner inspirierte die Ausdruckstänzerin Gret Palucca, die 1925 in Leibergs Heimatstadt Dresden ihre Tanzschule eröffnete, zu einem Bildnis, das einem zarten zerbrechlichen Frauenkörper widerspricht. Er malt sie 1929 mit auffällig derben Händen und Füßen.
Im Ausdruckstanz geht es ebenfalls um Freiheit, zunächst um die Befreiung von den Ballettschuhen, denn hier wird barfuß getanzt, aber auch um den Traum eines von allen äußeren Zwängen befreiten Menschen. Es geht nicht vorrangig darum, ein Publikum zu unterhalten, sondern um das Ausdrücken und Verarbeiten von Gefühlen der tanzenden Personen. Körper, Geist und Seele sollen sich miteinander verbinden. Die Tänzerin Isadora Duncan formuliert es so: „…denn ‚der höchste Geist‘ kann nur im ‚freiesten Körper‘ leben“ (1) Und Carola Stern beschreibt ihren Tanz folgerichtig mit den Worten: “Das Ich stand im Mittelpunkt, frei von allen Fesseln, von Schuld und Scham, aus sich selbst seine eigenen Gesetze, seine Form und sein Selbstbewußtsein gestaltend.“ (2)
Diese Prämisse treibt auch den Künstler Leiberg seit mehr als drei Jahrzehnten um, und in der Dreidimensionalität der Skulptur drückt sich dies in eindrücklicher Weise aus. Das Biegen, Drehen, Wenden, Verrenken der Körper und der übertrieben langen Extremitäten vergegenwärtigt uns das Raum schaffen Wollen für das Selbst besonders plastisch. Häufig strecken sich beide Arme oder ein Arm so weit in die Höhe oder zur Seite, dass eine maximale Ausdehnung stattfindet und sogar ein über sich hinaus Wachsen angedeutet wird. Grenzen für die Entfaltung soll es möglichst keine geben, kein Bildrand oder Blattrand beschränkt sie. Die expressive Gestik der Körper strebt in ihren ausladenden Bewegungen meist in die Weite. Das Medium Skulptur scheint für den Künstler das Höchstmaß an Entfaltungspotential für die innere Freiheit und deren Erprobung zu bieten.
In der Beobachtung und Zusammenarbeit mit Tänzerinnen, ebenfalls bereits in DDR-Zeiten praktiziert, nimmt die immer wieder weiter entwickelte und sich auf andere Medien ausbreitende künstlerische Sicht- und Darstellungsweise ihren Anfang. Bereits damals arbeitete Leiberg mit der Tänzerin Fine Kwiatkowski zusammen, mit der er die lebendige Kooperation zwischen den Künsten auch später im Westen fortsetzt. In der Beschreibung ihrer Tanzkunst durch einen Musikerkollegen finden sich nicht nur Aussagen, die sich auf Leibergs Bildende Kunst übertragen lassen, sondern bezeichnenderweise auch Begriffe wie „Skulptur“ und „Bilder“.
„Fine Kwiatkowski offenbart mit ihrer außergewöhnlichen und hoch differenzierten Körpersprache, dass die Grenzen dessen, was durch Bewegung sagbar ist, noch immer nicht festgeschrieben sind. Sie intensiviert innere Zustände, manifestiert sie durch unverwechselbare Bewegungen im Raum, in der Abfolge bis hin zur Skulptur, indem sich ihr Tanz, ein nur mit persönlichem Atem einzugebender Code, mit den Klängen und Bildern verschränkt.“
(Urs Leimgruber, Saxophonist, 2002) (3)
So, wie die Tänzerin, strahlen die Leibergschen Figuren Souveränität und Selbstbewusstsein aus, sie trauen sich etwas: sich zu lieben, sich zu streiten, aufzubrechen, sich zu zuwenden, sich ab zuwenden, zu toben, zu verwirren, zu verführen , zu zögern, zu werben, an zu greifen, sich hin zu geben, sich auch mal zurück zu ziehen und sich zu versenken. Sie können alles wagen, denn die Angst, sich selbst zu verlieren, existiert nicht. Sie stehen ganz für sich, während sie in der Malerei auch ihren Standpunkt in einem Gefüge bestimmen müssen, ihren Platz in einem übergeordneten System einnehmen, sei es ihren Bestimmungsort auf der Bildfläche oder im Weltgefüge.
Sicher ist es auch kein Zufall, dass die Skulptur das jüngste Medium ist, dem sich der Künstler zugewendet hat. Sein Kollege und Freund A.R.Penck sagt über das Arbeiten in Bronze: „Wenn der Mann in die Jahre kommt, will er sich der Ewigkeit aufprägen…Irgendwie kommt man in das Alter, wo man denkt, man will was Dauerhaftes machen.“ (4)
Leiberg hat entschieden, dass es diese, seine von ihm über Jahrzehnte entwickelte Figur sein soll, der er in diesem Material ein Denkmal setzt. Sie hat Jahr um Jahr gekämpft und geliebt, sich ihre innere Standfestigkeit errungen und kann nun auch in der wildesten Bewegung ganz sicher auf nur einer Zehenspitze stehen.
Diesen Part hat Leiberg in erster Linie den Frauen zugedacht. In seinen Frauenfiguren reproduziert er keine Schablonenschönheiten nach DIN Norm der Schönheitschirurgen oder nach Modeströmungen. Die schönen runden Hüften, die spitzen Brüste, die knackigen Pos sind durchaus verführerisch, stehen aber im Spannungsverhältnis zu den meist derben Füßen und großen Pranken der Damen. Sie sind zeitlos, nackt, sie müssen sich nicht über Kleidung, Haarfrisuren, Schminke definieren. Sie werden zu einem Menschheitsmodell. Ihre Anmut entspringt einer natürlichen Überzeugungskraft, einer bodenständigen Koketterie. Sie müssen keine Spitzenschuhe tragen, um auf den Zehenspitzen zu balancieren, sie können das auch so, denn das innere Gleichgewicht gibt ihnen das entsprechende Stehvermögen. Sie brauchen keine Kosmetikbranche, keine Diätratgeber, keine Modelmaße. Sie fegen und springen über alle Tipps der Frauenzeitschriften hinweg, denn sie befinden sich auf einer anderen Bewusstseinsebene.
Ihre Haltung sollte uns zu denken geben, den Frauen und den Männern. Den Weg der Selbstbestimmung zu gehen, Ballast abzuwerfen, lohnt sich immer. Tragisches und Komödiantisches wird unterwegs gegeben, im 1.Rang könnte ein Künstler sitzen mit seinem gezückten Skizzenbuch und unsere Bemühungen mit schmunzelnder Ernsthaftigkeit in Pirouetten, Ekstasen, Meditationen, Reigen, Balztänze, Traumwalzer oder Rock‘ n Roll verwandeln. Eine Andere könnte dies mit Worten in ihre Kladde kritzeln.
Die Glieder strecken
über uns hinaus springen
in uns hinein schlüpfen
die Beine spreizen
dem Anderen entgegen stolzieren
sein Herz stürmen
miteinander turteln
gegenseitig tätscheln
es miteinander treiben
das Wichtige stemmen
das Unwichtige torpedieren
toben und streiten
tingeln und tänzeln
über die Welt hinweg tanzen
schlenkernd in die Freiheit taumeln
im Selbst triumphieren
Christiane Bühling
(1) Carola Stern Isadora Duncan Sergej Jessenin, Rowohlt Berlin 1996, S.29
(2) Ebda., S.28
(3) A.R. Penck über Skulptur, aufgezeichnet von Ulrich Weisner, in: Ausstellungskatalog Raumbilder in Bronze: Per Kirkeby – Markus Lüpertz – A.R.Penck, Kunsthalle Bielefeld (Hrsg.), Bielefeld 1986, S. 146
(4) Rhizom TanzPerformanceTheater , Homepage von Fine Kwiatkowski